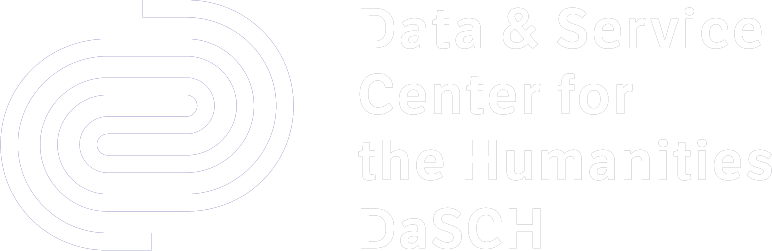Zur Zeit liegen erste Ergebnisse zur Wirksamkeit des Freiburger Stresspräventionstrainings bis zu sechs Monaten vor. Zur Wirksamkeit des Ansatzes befragt, geben 74% der Paare eine subjektiv wahrgenommene Verbesserung der Partnerschaftszufriedenheit infolge des Trainings an, 92% bemerken eine Zunahme der Kommunikationsqualität, 82% eine Steigerung ihrer Problemlösekompetenzen und acht von zehn Paaren geben eine Verbesserung beim individuellen und dyadischen Coping an. Zwei Drittel der Paare nehmen zudem eine Zunahme ihrer Lebenszufriedenheit und beruflichen Leistungsfähigkeit wahr und geben an, dass die gegenseitige Beachtung, Zeit füreinander und Lust auf Sexualität infolge des Trainings angestiegen seien. Im Vergleich zur Kontrollgruppe sind sämtliche Verbesserungseinschätzungen bei der Interventionsgruppe in der zweifaktoriellen Varianzanalyse (Gruppe x Geschlecht) uni- wie multivariat signifikant höher (bei der Kontrollgruppe liegt eine Spontanremission um die 20% vor) und erreichen zum Zeitpunkt der Postmessung mittlere bis starke Effektstärken1. Die Effektstärken liegen für die Partnerschaftszufriedenheit bei d = 1.13 für die Frauen und d = 1.21 für die Männer, für die dyadische Kommunikation bei d = 1.74 bei den Frauen und d = 1.97 bei den Männern, für die Problemlösung bei d = 1.70 für die Frauen und d = 1.83 bei den Männern, beim individuellen und dyadischen Coping bei d = 1.44 respektive 1.48 bei den Frauen und d = 1.36 respektive 1.53 bei den Männern. Bezüglich Intimität/Nähe und Lust auf Sexualität liegen Effektstärken von d =.94 respektive.55 bei den Frauen und d =.81 respektive.53 bei den Männern vor.
Zwischen dem Zeitpunkt der Post-Messung und dem Follow-up nach sechs Monaten werden in der Varianzanalyse weitere signifikante Verbesserungen (ausser bei Intimität/Nähe und Sexualität) festgestellt, welche Effektstärken von d =.40 bis.92 bei der Partnerschaftszufriedenheit und den Zielkompetenzen erreichen. Bezüglich Intimität/Nähe und Lust auf Sexualität liegen zu diesem Messzeitpunkt Effektstärken von d =.24 respektive.16 bei den Frauen und d =.38 respektive.49 bei den Männern vor. In Varianzanalysen mit zwei Within-Faktoren (drei Messzeitpunkte x Geschlecht) und dem Between-Faktor Gruppenzugehörigkeit (3 x 2 x 2) bestätigen sich die subjektiven Angaben der Paare auch im Rahmen der verwendeten Fragebogen (PFB; FDCT-N, KOMQUAL, CPQ usw.). Die Interventionsgruppenpaare weisen zu den Messzeitpunkten Post (zwei Wochen nach dem Training) und 1. Follow-up (nach sechs Monaten) signifikant höhere Werte in der Partnerschaftsqualität und -zufriedenheit (im PFB von Hahlweg, 1996) im Vergleich zu vor dem Training auf, erleben die Qualität ihrer Beziehung als besser und weniger problematisch und äussern weniger Trennungsabsichten als vor dem Training. Ebenso verbessert sich die Kommunikationsqualität der Paare signifikant. Interessant ist, dass die positiven Veränderungen insgesamt v.a. auf eine Abnahme von negativen Aspekten in der Partnerschaft zurückzuführen sind und nur beschränkt auf eine effektive Erhöhung der Positivität zurückgehen. So nehmen nach dem Training insbesondere die Skalen Streitverhalten (im PFB) und negative Kommunikation (im KOMQUAL) ab, während bei den positiven Skalen (z.B. Zärtlichkeit und Gemeinsamkeit im PFB) nur leichte (statistisch nicht signifikante) Verbesserungen feststellbar sind. Insgesamt liegen die Effektstärken bezüglich der Partnerschaftsqualität, Partnerschaftszufriedenheit und Problematik der Beziehung zwischen d =.20 bis.30 zum Zeitpunkt der Post-Messung und zwischen d =.20 bis.44 zum Zeitpunkt des Follow-up. Die stärksten Effektstärken liegen bezüglich der Abnahme der Einschätzung der Partnerschaft als problematisch (dpost =.29; dfollow-up =.44) und bei der Skala Streitverhalten vor (dpost =.33; dfollow-up =.37). Die Effektstärken im Rahmen der Kommunikation liegen zwischen d =.37 bis.47 zu t2 und d =.44 bis.48 zum Zeitpunkt des Follow-up. Dabei zeigt sich durchgehend, dass die Effekte bei den Paaren höher liegen, welche die im Training vermittelten Kompetenzen im Alltag anzuwenden angeben (bis d =.65 zu t2 und.86 zu t3), während die Paare mit geringer Anwendungshäufigkeit kaum Verbesserungen erfahren oder diese lediglich von kurzer Dauer sind (vgl. Bodenmann, Cina & Widmer, 1998).
Neben der generellen Verbesserung der Partnerschaftsqualität konnten Bodenmann, Perrez, Cina und Widmer (im Druck) ebenfalls signifikante Verbesserungen bezüglich den Belastungsbewältigungskompetenzen infolge des FSPT nachwiesen. Mit Effektstärken von d =.37 bis.46 beim funktionalen individuellen Coping und d =.50 bis.59 beim dysfunktionalen individuellen Coping respektive d =.38 beim dyadischen Coping liegen mittelstarke Verbesserungen vor. Leider liegen zur Zeit die Videoauswertungen noch nicht vor, so dass zu diesem Teil der Wirksamkeitsüberprüfung noch keine Angaben gemacht werden können.