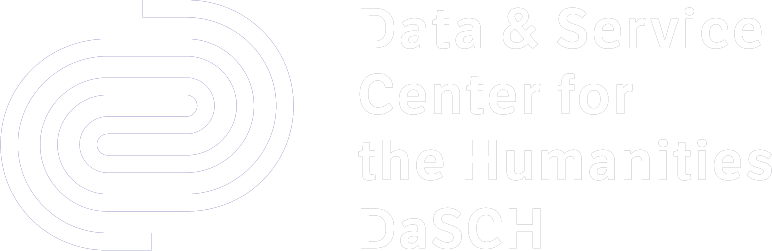1. Ausgangslage und Zielsetzung
Der grundlegenden Problemstellung und dem Bedürfnis der Auftraggeber entsprechend wird die Untersuchung als formative und entwicklungsorientierte Evaluation ausgestaltet. Das primäre Ziel besteht somit darin, wissenschaftlich fundierte Grundlagen zur Verbesserung des Projektverlaufs zu erarbeiten. Dem Einbezug der Betroffenen und Beteiligten soll grosses Gewicht beigemessen werden, um damit dem Anspruch zu genügen, dass die Evaluation für die Beteiligten lernorientiert und für die Schulen und Projektverantwortlichen entwicklungsorientiert ist. Überdies muss eine optimale Ablaufplanung gewährleisten, dass notwendige Prozess-Inputs auch zeitgerecht erbracht werden können. In zweiter Linie besteht - aus der Sicht des auftragerteilenden Steuerausschusses - die Absicht, auf der Basis dieser Fremdevaluation gegenüber den zuständigen Stellen Rechenschaft über den Reformverlauf und die erzielten Resultate zu geben. Die externe Evaluation muss im weiteren einen ausgeprägten Dienstleistungscharakter aufweisen, den Reformprozess also unterstützen und ihn nicht etwa zusätzlich belasten. Dies bedingt einerseits eine entsprechende Projektplanung, vor allem in der Frage der Datenerhebung, und anderseits eine Konzeption, die nicht nur in der Lage sein muss, Schwachstellen im Reformverlauf (und damit Ansatzpunkte für Prozessverbesserungen) zu identifizieren, sondern auch Stärken und Erfolge hervorzuheben, um die erbrachten Leistungen gegen Innen (Motivation) wie gegen Aussen (Rechenschaft) ausweisen zu können.
2. Grobkonzept: Selbstevaluation und Fremdevaluation
Die Steuergruppe Gymnasialreform sieht in ihrem "Grobkonzept Reformevaluation" neben der Fremdevaluation eine umfassende Selbstevaluation der einzelnen Schulen vor. Das Grobkonzept definiert die inhaltliche Abgrenzung wie folgt: "Die Schulen evaluieren im Rahmen dieses Konzeptes ihre Reformarbeiten selber. Dabei sind sowohl auf der Unterrichts- als auch auf der Schulebene Erfahrungen zu dokumentieren. (...) Die externe Evaluationsstelle evaluiert die kantonalen Projektgremien, sichtet die Evaluationsberichte der Schulen, vergleicht sie untereinander und arbeitet die übergreifende Sicht auf den Stand der Reform heraus. Sie fasst die Ergebnisse aller Schulen zusammen und würdigt sie. Die externe Evaluationsstelle macht die Fremdevaluation." Durch die Implementation des MAR ergibt sich eine zeitliche Staffelung zwischen Langzeitgymnasium (einschliesslich Maturitätsschule für Erwachsene MSE) und Kurzzeitgymnasium. Die Analyse und Steuerung des Reformprozesses macht eine Aufteilung in zwei Projektphasen notwendig.
3. Konzeption der Fremdevaluation
Das Konzept für die Fremdevaluation basiert auf einem modularen Aufbau, der den Zielsetzungen des Auftrages und der im Grobkonzept definierten Funktion der Fremdevaluation Rechnung trägt. Im folgenden werden die einzelnen Module charakterisiert und die in der jeweiligen Phase der Reformevaluation anstehenden Themen und Fragestellungen definiert. Darüberhinaus wird skizziert, mit welchen methodischen Instrumenten gearbeitet wird und welcher voraussichtliche Aufwand daraus entsteht.
3.1 Modul 1: Evaluation der kantonalen und schulbezogenen Projektorganisation
Dieses Modul befasst sich schwergewichtig mit den Fragen nach den Erfahrungen mit der Projektorganisation im Rahmen der kantonalen Projektleitung und auf der Stufe der einzelnen Schulen, mit der Auftragserfüllung der Projektorgane sowie mit den Schnittstellen zwischen den kantonalen Projektgremien und den einzelnen Schulen. Die Evaluation in diesem Modul dient dazu, Entwicklungsmöglichkeiten im Projektablauf zu identifizieren sowie Leistungsverstärkungen bzw. alternative Handlungsoptionen aufzuzeigen.
3.1.1 Fragestellungen
- Wie gestaltete sich die Arbeit der Projektorgane auf der Ebene der einzelnen Schule bzw. auf kantonaler Ebene? Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den kantonalen Projektorganen?
- Welche Wirkung hat die Projektorganisation auf der Ebene der einzelnen Schule bzw. auf kantonaler Ebene erzielt? Konnte der vorgegebene Auftrag im Rahmen des Reformprozesses mit der gewählten Projektorganisation zweckmässig erfüllt werden?
- In welchem Verhältnis standen Aufwand und Ergebnis bei der Arbeit der Projektorgane auf der Ebene der einzelnen Schule bzw. auf kantonaler Ebene?
- Welche Änderungen und Optimierungen müssten für den weiteren Verlauf des Reformprozesses auf der Ebene der Organisation und der Prozesssteuerung vorgenommen werden?
3.2 Modul 2: Meta-Evaluation der Selbstevaluation der einzelnen Schulen und vergleichende Synthese der Selbstevaluationen
Zum einen hat dieses Modul zum Ziel, die Selbstevaluationen der einzelnen Schulen einer kritischen Überprüfung im Hinblick auf ihre Qualität zu unterzielen (Meta-Evaluation). Die Auswertungsergebnisse der einzelnen Selbstevaluationen haben dabei insofern einen Eigenwert, als sie zu einer Qualitätssteigerung der Selbstevaluationen beitragen und in den einzelnen Schulen dazu verhelfen, die Organisation, den Bearbeitungsprozess, die methodischen Aspekte und die inhaltliche Aussagekraft der Selbstevaluationen nötigenfalls zu verbessern. Die Ergebnisse der Meta-Evaluation in der 1. Phase werden zwischen dem externen Evaluationsteam und der jeweiligen Schule an einer halbtägigen Feedback-Sitzung besprochen. Zum andern ermöglicht dieses Modul auf der Basis der inhaltlichen Analyse und Beurteilung der Selbstevaluationen der beteiligten Schulen eine vergleichende Synthese über die Gestaltung des Reformprozesses an den Schulen und über die inhaltlichen Resultate der an den Schulen erfolgten Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Evaluationsthemen.
3.2.1 Fragestellungen Meta-Evaluation
- Sind die zu evaluierenden Fragestellungen klar formuliert?
- Geben die Evaluationsergebnisse Antworten auf die formulierten Fragestellungen?
- Sind die angewendeten methodischen Instrumente korrekt und zweckmässig?
- In welcher Art wurden Schlüsse aus den gewonnenen Ergebnissen gezogen? Vergleichende Synthese der Selbstevaluationen
- Vergleich der methodischen Zugangsweise und formale Aspekte der Selbstevaluation
- Vergleich über die behandelten Themen: Übereinstimmungen, Differenzen, Art der vorgeschlagenen Massnahmen
- nicht vergleichbare Evaluationen: Gründe für die Nicht-Vergleichbarkeit; notwendige Nachfragen, um Vergleichbarkeit - wo nötig - herzustellen
3.3 Modul 3: Fremdevaluation der Schulen
Verschiedene schulinterne Themenfelder sind in Ergänzung zur Selbstevaluation an den einzelnen Schulen auch Gegenstand der externen Evaluation. Die einzelnen Fragestellungen innerhalb der durch den Steuerausschuss vorgegebenen Thematas werden - in Absprache mit der Steuergruppe - durch das Evaluationsteam strukturiert und unter vergleichbaren Kontextbedingungen an den einzelnen Schulen abgefragt. Bezogen auf einzelne Fragestellungen werden zur Überprüfung der Wirksamkeit von Prozessen und Massnahmen verschiedene Akeurgruppen an den einzelnen Schulen (Lehrteam, Fachschaften, SchülerInnen) in die Befragungen miteinbezogen. Die Datenerfassung der Fremdevaluation muss einerseits auf den unterschiedlichen Verlauf des Reformprozesses an den Langzeit- und Kurzzeitgymnasien, anderseits auf zusätzliche weitere Reformprozesse an einzelnen Schulen (z.B. Projekt NWEDK am LZG Beromünster, WOV-Projekt am LZG Sursee) Rücksicht nehmen. Durch die Anwendung auch qualitativer und diskursiver Methoden (Leitfaden-Interviews, Gruppengespräche, Workshops zur Validierung) soll ermöglicht werden, dass die Fremdevaluation und ihre Ergebnisse auch zum Nutzen der einzelnen Schule als lernende Organisation werden. Die Fremdevaluation wird terminlich bewusst im Anschluss an die vergleichende Synthese der Selbstevaluationsberichte vorgesehen, damit Unklarheiten und Differenzen aus den Selbstevaluationen berücksichtigt werden können.
3.3.1 Fragestellungen 1. Phase Wahlfachangebot
a) Ebene Schulen (Befragte: Schulleitungen, Lehrteam, SchülerInnen)
- Wie wurde das Wahlfachsystem an den Schulen organisiert? (Angebotsbildung; Information der SchülerInnen; zeitliche, räumliche und personelle Organisation)
- In welchem Verhältnis stand das von der Schule geplante Wahlfachangebot zur Nachfrage der SchülerInnen?
- Welche Konsequenzen hatte das Wahlverhalten der SchülerInnen für die Schule?
b) Ebene Kanton (Befragte: Gruppe G EKD, Schulleitungen, Reformbeauftragte der Schulen)
- Welches sind die Erfahrungen mit der Koordination des Wahlfachangebotes auf kantonaler Ebene? Schienenmodell (Befragte: Schulleitungen, Fachschaften, LehrerInnenteam)
- Welches sind die Erfahrungen mit dem Schienenmodell am LZG?
3.3.2 Fragestellungen 2.Phase Matura (Arbeit und Prüfung)
- Inwiefern hindert bzw. fördert das neue Maturitätsprüfungsreglement die Reformbestrebungen der Schulen (fächerübergreifender Unterricht, Teamentwicklung, Prüfungsformen etc.)
- Welches sind die Erfahrungen mit den Richtlinien und Empfehlungen zur Abfassung der Maturaarbeit? (Umsetzbarkeit)
- Welche Erfahrungen wurden mit den Maturaprüfungen und den Maturaarbeiten gemacht? (Veränderungen gegenüber früher) Lehrplan
- Wie gestaltete sich die Lehrplanarbeit (Zielformulierung, Erarbeitung und Umsetzung des Lehrplans)?
- Welches sind die Erfahrungen und Wirkungen nach der Einführung und Umsetzung des neuen Lehrplans? Fächerübergreifender Unterricht und Wahlfachangebot
- Wie wurde das Konzept des fächerübergreifenden Unterrichts erarbeitet und umgesetzt? (Ziele, Ressourcen, Organisation)
- Welche Erfahrungen wurden im Zusammenhagng mit diesem Konzept des fächerübergreifenden Unterrichts gemacht? (Ressourcen, Organisation, pädagogische Wirkung)
- Welches sind die Erfahrungen mit dem Wahlfachsystem? (auch: Veränderungen gegenüber Phase 1)
- Wie ist das Wahlverhalten der SchülerInnen und ihre Erfahrungen mit dem Wahlfachsystem? (Angebot, Organisation, Qualität, Nutzen) Langzeit- und Kurzzeitgymnasien
- Welches sind die Erfahrungen mit dem getrennten Führen von LZG und KZG an den Schulen Luzern und Sursee?
3.4 Beratung der Projektleitung und Mitwirkung in der Aus- und Weiterbildung der Evaluationsverantwortlichen Dieses Modul dient primär der Unterstützung der Projektleitung in evaluationsspezifischen Fragen. Seine Ausgestaltung erfolgt aufgrund der Wünsche der kantonalen Projektleitung und kann im Verlauf des Projektes den sich verändernden Bedürfnissen angepasst werden. Ergänzt wird der Leistungsauftrag durch die Planung und die Mitwirkung an der Aus- und Weiterbildung der Evaluationsbeauftragten in den einzelnen Schulen im Bereich Konzipierung, Organisation und Durchführung von Selbstevaluationen.