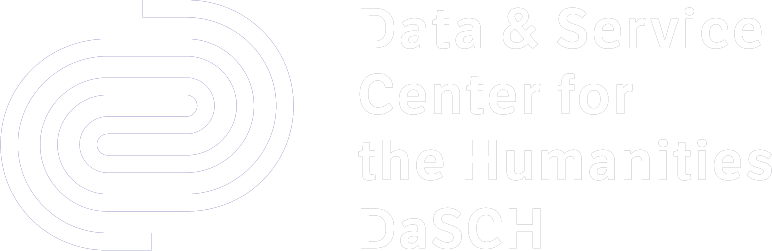Beträgt der Anteil der Frauen im Architekturstudium noch an die 40 Prozent, so sind sie im Beruf mit einem Anteil von 12 Prozent massiv untervertreten. Diese Diskrepanz ist in der Architektur grösser als etwa in den Berufen im Bereich der Medizin oder des Rechts. Weshalb gelingt es den Architektinnen nicht, ihren Bildungsabschluss in Berufspositionen umzusetzen? Die Autorin hat im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 43 ("Bildung und Beschäftigung") die Mechanismen untersucht, die dazu führen, dass Frauen zwar mit Begeisterung Architektur studieren, im Beruf aber bis heute nicht richtig haben Tritt fassen können. Dabei hat sich gezeigt, dass im Ausbildungs- und Berufsfeld Architektur komplexe Prozesse wirken, die, wenn sie sich kumulieren und überlagern, für Frauen zu Ausschlussmechanismen werden.
Die Autorin stellt die wichtigsten dieser Prozesse in Form von sieben Thesen vor. Diese betreffen folgende Bereiche: (1) Rollenvorbilder: Dass Frauen sowohl in der Professorenschaft wie unter den Stars der Architektur kaum vertreten sind, erschwert angehenden Architektinnen die Integration in die berufliche Community. (2) Geschlechtstypische Studienmotive: Die unterschiedlichen Motive, mit denen Männer und Frauen ihre Studienwahl begründen, widerspiegeln das implizit "männliche Geschlecht" der Architektur. (3) Hochschule als Sackgasse: Das in der Architektur geläufige Karrieremodell straft die Stilisierung der Hochschule als eine für Frauen attraktive Gegenwelt zur harten Berufsrealität Lügen. (4) Der Mythos vom vereinnahmenden Kunstberuf: Mangel an Teilzeitstellen und eine Kultur der Entgrenzung von Beruf und Privatem erschweren die Vereinbarkeit des Architekturberufes mit einer Mutterschaft. (5) Der Bau als männlich dominierte Welt: Frauen sind in der Baubranche Ausnahmeerscheinungen und deswegen einer besonderen Aufmerksamkeit und Kontrolle ausgesetzt. (6) Männlich inszenierte Professionalität: Zu einem professionellen Auftritt gehört in der Architektur die Zurschaustellung von Kompetenz in Sachen "guter Form". Auf dieser symbolischen Ebene sind Architektinnen qua ihres Geschlechts gegenüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt. (7) Kultur der Informalität: Karriereverläufe sind in der Architektur kaum formalisiert und es herrscht wenig Konsens über Qualitäts- und Selektionskriterien. Damit wird einerseits jungen Architektinnen die Übereinstimmung von Karriere- und Familienplanung erschwert, und andererseits besteht die Gefahr, dass partikulare Kriterien wie das Geschlecht in Selektionsentscheide einfliessen.