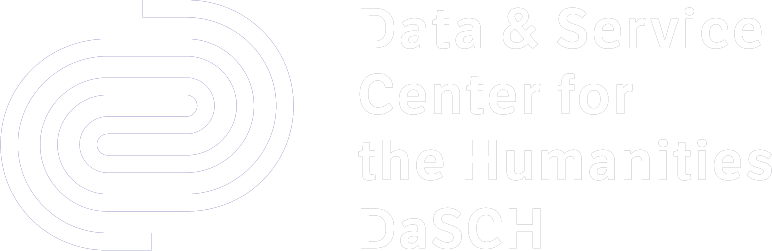Um Näheres zu wissen über die Dringlichkeit der Problematik des Schulausschluss und seiner rechtlichen Regelung hat das Volksschulamt der zürcherischen Bildungsdirektion im April 2004 die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) beauftragt, bei den Schulen der Sekundarstufe I eine entsprechende Umfrage vorzunehmen. Es ging vor allem um Antworten auf die folgenden Fragen: o In wie vielen Schulen kam es im Schuljahr 2003/04 zu einem befristeten oder definitiven Schulausschluss und wie viele Schülerinnen und Schüler waren betroffen? o Was waren jeweils die Auslöser des Schulausschlusses? o Welche begleitenden Massnahmen wurden ergriffen (Betreuung, Begleitung usw.) während des Schulausschlusses? o Wie erfolgreich war die Wiedereingliederung? o Wie gut gelingt es den Schulen, dieses Problem zu handhaben? Benötigen sie Unterstützung? Da die HfH gegenwärtig im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 51 ("Integration und Ausschluss") in einem Projekt zur Frage des disziplinarischen Schulausschlusses involviert ist, konnte der Auftrag des Kantons einerseits von Daten aus dem NFP-Projekt profitieren, während andererseits die Zürcher Daten anonymisiert ins NFP-Projekt eingespeist wurden. Die schriftliche Umfrage bei den Schulgemeinden ergab eine Rücklaufquote von rund 80 Prozent. Die Antworten berichten von insgesamt 119 Fällen von Schulausschluss in 73 Schulen. Die Quote der von einem Ausschluss Betroffenen beträgt somit rund ein halbes Prozent. Bei sieben von zehn Ausgeschlossenen war der Ausschluss definitiv, d. h. sie kehrten nicht mehr in die Schule zurück. Vier von fünf Betroffenen waren männlichen Geschlechts. Mehr als die Hälfte der Betroffenen hatten keinen Schweizer Pass, während in der Gesamtpopulation der betroffenen Schulstufe dieses Kriterium nur auf 27,5% zutrifft. Als Ziel des Ausschlusses wird bei Jungen in der Regel angegeben, es sei schlicht darum gegangen, den betroffenen Schüler von der Schule zu entfernen. Bei den Mädchen hingegen wird der Ausschluss häufig als Lösung oder Ausweg für die Schülerin beschrieben. In der Mehrzahl der Fälle werden für die Dauer des Ausschlusses begleitende Angebote bereitgestellt. Der Ausschluss wird als gravierende Massnahme erachtet; gleichzeitig besteht Einigkeit, dass er in gewissen Fällen unumgänglich ist. Die Schaffung rechtlicher Grundlagen ist deshalb eine deutliche Forderung an die Erziehungsbehörden.