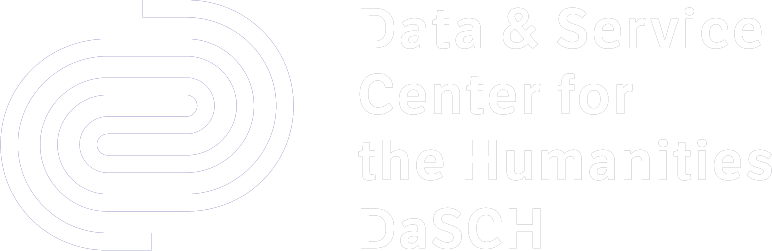Die Evaluation von Einzelschulen oder auch von ganzen Bildungssystemen hat derzeit Konjunktur. Nebst der Leistung in einzelnen Schulfächern stellen bei diesen Untersuchungen auch die überfachlichen Kompetenzen wichtige Bewertungskriterien dar. In einem solchen Zusammenhang definiert und misst die hier vorgelegte Arbeit - Dissertation an der Universität Zürich - das Interesse an ständiger Weiterbildung und sucht so die Motivation als Ergebnis des Bildungsprozesses zu erfassen. In Ergänzung dazu werden verschiedene motivationale Orientierungen im Hinblick auf schulisches Lernen allgemein und für das Fach Mathematik im besonderen als Prozessvariablen untersucht, dies in Anlehnung an die Theorie der Selbstbestimmung von Deci und Ryan.
Untersuchungen, die im Rahmen der schweizerischen Beteiligung am internationalen Projekt TIMSS (Third International Mathematics and Science Study, Haupterhebung 1995) durchgeführt wurden, führten zur Bestimmung fünf derartiger motivationaler Orientierungen, die sich in ihrer Itemstruktur über die Populationen (Sekundarstufe I versus Sekundarstufe II) und über das Gebiet (Mathematiklernen versus schulisches Lernen allgemein) hinweg als stabil erwiesen. Es sind dies die folgenden Orientierungen: (1) intrinsisch: die Lernaktivität macht an sich schon Spass; (2) langfristig-instrumentell: das Lernen verspricht langfristigen Nutzen; (3) leistungsbezogen: sein Bestes geben ist eine gute Sache; (4) anerkennungsbezogen: motivierend wirkt die Anerkennung seitens von Eltern, Freunden, Lehrpersonen usw.; (5) Amotivation: der Lehr-/Lernprozess wird passiv hingenommen.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, von einem bipolaren Modell "intrinsische vs. extrinsische Motivation" auszugehen, sondern dass die extrinsische Motivation differenziert zu werden verdient. Hier hat sich die in der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan nicht vorgesehene Kategorie der Motivation durch langfristigen Nutzen als besonders interessant erwiesen. Sie zeigt etwa auf der Sekundarstufe I eine von den anderen Orientierungen abweichende und nach Geschlecht differenzierte Entwicklung und am Ende der Sekundarstufe II einen ausgeprägten Geschlechtsunterschied in bezug auf Mathematik, nicht aber in beim schulisches Lernen allgemein, sowie einen starken Einfluss auf die Wahl des Maturitätstyps und damit auf die Mathematikleistungen. Aus den Ergebnissen lässt sich etwa die Folgerung ableiten, den Mädchen die Perspektive einer technischen oder naturwissenschaftlichen Laufbahn schmackhaft zu machen sei mindestens ebenso wichtig, wie den Mathematikunterricht geschlechtergerecht zu gestalten.