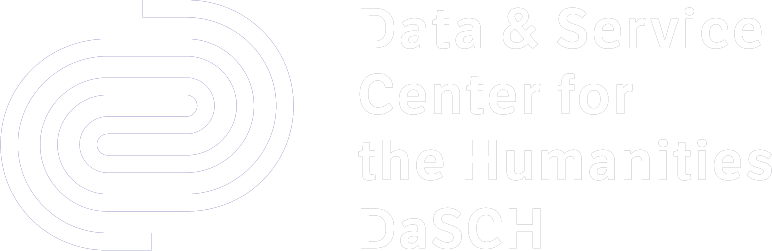Im deutschsprachigen Raum zumindest, in welchem die vorliegende Dissertation entstanden ist, ist schon viel über die pädagogische Grundlegung des Werks von Maria Montessori geschrieben worden. Bei näherem Hinsehen zeigt es sich laut der Verfasserin der Dissertation allerdings schnell, dass die in diesen Texten herangezogenen Zitate aus dem Werk Montessoris häufig relativ willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen worden sind und mehr über die anthropologischen Vorlieben der Montessori-Rezipienten aussagen als über die bekannte italienische Pädagogin. Dieser etwas bedauerliche Zustand wird unter anderem auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass eines der wichtigsten und umfangreichsten Werke Montessoris, die nahezu gleichzeitig mit Il metodo della pedagogia scientifica publizierte Antropologia pedagogica (1910), bisher nie ins Deutsche übertragen worden ist. Auf der Analyse dieses letzteren Werks basiert die Autorin ihre Doktorarbeit, und sie unternimmt es gleichzeitig aufzuzeigen, dass Montessoris Erziehungsmethoden sehr wohl auf diesen anthropologischen Grundannahmen beruhen. Die Arbeit zeigt auf, wie sehr das Denken Maria Montessoris von positivistischem Gedankengut und Glauben an die Machbarkeit der Dinge geprägt ist. Der Zweck des Bildungsprozesses besteht in der Perfektionierung der menschlichen Zukunft auf dem Weg der Verbesserung der hygienischen Bedingungen, dies auf physischem wie auf psychisch-moralischem Gebiet. Ihre Ausführungen zu den Vererbungsgesetzen unterstreichen die enormen Hoffnungen, die in jenen Jahren auf das neue Wissen über Genetik und Vererbung und das allenfalls möglich werdende Eingreifen in die diesbezüglichen Vorgänge gesetzt wurden. Das Ziel der Pädagogik nach Montessori liegt im übrigen auch nicht in der Entfaltung der spezifischen Eigenheiten und Gaben jedes einzelnen Menschen, sondern in der Herstellung des "homme moyen" von Adolphe Quetelet, einem der frühen Menschenvermesser, also der Produktion eines abstrakt und mit Beihilfe der Statistik definierten Normalfalls. Kurz: das Denken Maria Montessoris ist durch und durch von ihrer Zeit geprägt, und es weist etliche Züge auf, die fundamental undemokratisch sind. Die Autorin möchte ihre Arbeit ausdrücklich nicht als Angriff auf das gerichtet sehen, was heute als Montessori-Pädagogik betrieben wird. Sie ist im Gegenteil von der Qualität der entsprechenden pädagogischen Arbeit überzeugt; sie ist aber der Ansicht, der "Markenname" beruhe auf einem Missverständnis.