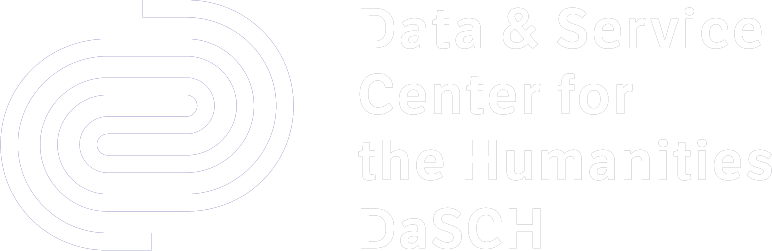Nicht nur die Frage, ob und unter welchen Bedingungen Personen im Alltag hypothesen-bestätigend vorgehen, sondern auch die Frage, welche kognitiven Strategien schlussendlich als Bestätigungsstrategien zu bewerten sind, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. So ist nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass Personen eine systematische Bestätigungsstrategie zeigen, wenn sie trotz widersprechender Informationen an einer Hypothese festhalten, die aufgrund von Erfahrungen eine hohe a priori Wahrscheinlichkeit besitzt, oder wenn Personen eine positive Teststrategie anwenden, also bevorzugt auf eine Weise nach Informationen fragen, so dass ein "Ja" der Informationsquelle eine Bestätigung der Hypothese bedeuten würde. Eine Bestätigungsstrategie liegt nur dann vor, wenn der Prüfprozess systematisch dazu beiträgt, falsche Annahmen zu konservieren. Dies ist unbestritten dann der Fall, wenn bestätigende Informationen systematisch stärker gewichtet oder besser erinnert werden als hypothesenwidersprechende. Eine klare Bestätigungsstrategie würde ebenfalls vorliegen, wenn Personen systematisch solche Informationsquellen aufsuchen würden, von denen sie a priori annehmen können, dass sie unterstützende Informationen liefern werden. Während die Frage der systematischen Gewichtungs- und Erinnerungsverzerrung Gegenstand zahlreicher Untersuchungen ist, wurde bisher kaum überprüft, ob Personen bereits bei der Aufsuche von Informationsquellen einen Bestätigungsbias zeigen. Genau diese Frage ist jedoch Gegenstand der im vorliegenden Projekt durchgeführten Experimente. Im Vorfeld der Experimente waren einige schwierige Probleme zu lösen: (1) Wie, und mit welchem experimentellen Szenario kann erreicht werden, dass Personen zwischen Informationsquellen wählen, von denen a priori zu erwarten ist, dass sie sich in bestimmter Weise äussern werden? (2) Welcher theoretische Ansatz ist präzise genug, um Bedingungen anzugeben, unter denen Personen eine Bestätigungsstrategie zeigen? Als theoretischen Ansatz wählten wir die Theorie von Trope und Liberman (1996), da sie auf sehr kohärente und umfassende Weise die Bedingungen präzisiert, unter denen eine verzerrte Hypothesenprüfung erwartet wird. Eine Verzerrung ist nach diesem Ansatz vor allem dann zu erwarten, wenn die subjektiven Kosten einer fälschlichen Hypothesenverwerfung und die Kosten einer fälschlichem Akzeptanz asymmetrisch hoch sind. Für die Informationssuche und die Informationsverarbeitung der hypothesentestenden Person bedeutet dies, dass ein Bias jeweils für diejenige Entscheidungsalternative besteht, die mit den geringeren Kosten verbunden ist. Als experimentelles Szenario wählten wir eine berufliche Situation, in der die Vp zu überprüfen hat, ob sie einem Kollegen K, mit dem sie zusammenarbeiten soll, vertrauen kann oder nicht. Wenn sie K fälschlicherweise misstraut und sich gegen ihn entscheidet, so läuft die Vp Gefahr, einen wertvollen Mitarbeiter zu verlieren und bei der Aufgabe zu scheitern (Misstrauenskosten). Vertraut sie K hingegen fälschlicherweise, so kann K nicht nur gegen sie intrigieren, sondern die Vertrauensseligkeit kann der Vp auch negativ vom Arbeitgeber ausgelegt werden (Vertrauenskosten). Um vor Beginn der Aufgabenbewältigung die Vertrauenshypothese zu überprüfen, kann die Vp nun von verschiedenen Kollegen von K Informationen erhalten, die für oder gegen dessen Vertrauenswürdigkeit sprechen. Die ersten Informationen wurden in den Experimenten jeweils vorgegeben, so dass bei der Vp eine Erwartung entstehen konnte, wie sich der betreffende Kollege über K äussern wird. Sodann erfolgten insgesamt 3 Durchgänge, in denen die Vpn die Kollegen auswählen konnten, von denen sie weitere Informationen haben wollten. In allen drei Experimenten, in denen jeweils Bedingungen der asymmetrischen Fehlerkosten gegeben waren, konnten wir belegen, dass Personen nahezu peinlich genau darum bemüht waren, in ausgewogener Weise Kollegen als Informationsquelle zu wählen, die sowohl für als auch gegen die Vertrauenswürdigkeit von K sprachen. Dieses Ergebnis ist insbesondere in Zusammenhang mit den zusätzlich gefundenen Ergebnissen des ersten Experiments interessant, denn diese belegen recht klar, dass Personen unter der Bedingung "hohe Misstrauenskosten" tatsächlich eine Tendenz haben, ihre Annahme "K ist vertrauenswürdig" zu bestätigen. Obwohl sie in ausgewogener Weise Informationen suchen, gewichten sie die vertrauenserweckenden Informationen stärker als die misstrauenserweckenden und entwickeln auch ein höheres Vertrauens in K als Vpn in anderen Bedingungen. Weitere Unterstützung des Ergebnisses, dass Personen eine diagnostische Informationssuche bevorzugen, bilden zum einen das Ergebnis einer Nachbefragung der Vpn und zum anderen das zweite Experiment, in welchem speziell überprüft wurde, ob eine diagnostische Informationssuche vielleicht nur dann auftritt, wenn die Ausgewogenheit des Datenmaterials für die Vpn durchschaubar, bzw. salient ist. Die Nachbefragung belegte, dass die Mehrheit der Vpn nicht nur ausgewogen vorging, sondern dies auch im nachhinein als eine wichtige Strategie erinnerte. Anhand des zweiten Experiments konnte gezeigt werden, dass die Ausgewogenheit bei der Selektion von Informationsquellen nur minimal abnimmt, wenn für die Vpn die Salienz der Ausgewogenheit des Datenmaterials zurückgeht, bzw. nicht mehr vorhanden ist. Trotz dieses interessanten Ergebnisses gibt es einige Probleme, die mit der Durchführung der Experimente und vor allem mit der Realisierung der "Fehlerkosten" verbunden waren und auf die im folgenden eingegangen werden soll: (1) Es erwies sich als überaus schwierig, die Kosten der fälschlichen Akzeptanz unabhängig von den Kosten einer fälschlichen Verwerfung der Vertrauenshypothese zu variieren. Beispielsweise mussten wir bereits bei der Planung bei fast allen denkbaren Operationalisierungen der Kosten eines fälschlichen Vertrauens feststellen, dass durch die Manipulation unweigerlich auch die Misstrauenskosten beeinflusst wurden. Im dritten Experiment operationalisierten wir beispielsweise die Vertrauenskosten, indem wir der Vp mitteilten, dass eine zu grosse Vertrauensseligkeit (=fälschliches Vertrauen) schlechte berufliche Konsequenzen für sie habe, da sie von den Vorgesetzten als Zeichen mangelnder Diagnosefähigkeit angesehen würde. Obwohl es richtig ist, dass man eine mangelhafte Diagnosefähigkeit in der Praxis meistens nur dann erkennt, wenn man sich für und nicht gegen eine Person entscheidet, müsste konsequenterweise auch ein fälschliches Misstrauen als Hinweis auf mangelnde Diagnosefähigkeit gewertet werden und entsprechende Kosten nach sich ziehen. (2) Ein weiteres Problem ist im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung des Rollenspiels zu sehen. Die Ergebnisse von Experiment zwei und drei zeigen, dass die Vpn selbst unter den Bedingungen hoher Fehlerkosten noch immer ihre "Selbstwirksamkeit", d.h., ihre Fähigkeit, die Aufgabe auch ohne K zu bewältigen, als sehr hoch einschätzten. Dies legt nahe, dass das Rollenspiel nicht real genug war, bzw. die jeweiligen Kosten, die mit dem einen oder anderen Fehler verbunden waren, von der Vp nicht wirklich "empfunden" wurden. Beispielsweise operationalisierten wir die Kosten des fälschlichen Misstrauens gegenüber K, indem wir die Abhängigkeit von K variierten. Hierzu war es nötig, dass K als eine wichtige und nahezu unersetzliche Person wahrgenommen wurde, die der Vp bei der Lösung einer anstehenden Aufgabe helfen können wird. Vermutlich reichte es nicht aus, diese Aufgabe nur zu beschreiben und anzukündigen. Es wäre besser gewesen, der Vp eine realistische Vorstellung davon zu vermitteln, was es heisst, diese Aufgabe gegebenenfalls ohne K lösen zu müssen und wie blamabel es sein kann, Misserfolg bei der Aufgabe zu haben. Möglicherweise hätte man das Problem der Fehlerkosten auch über die glaubwürdige Ankündigung finanzieller Verluste lösen können, aber hierfür fehlten die entsprechenden Mittel. (3) Ein drittes Problem schliesslich betrifft die Wahl der Informationsquelle. In dem gewählten Szenario dienten die Kollegen von K als Quelle, um sich über die Vertrauenswürdigkeit von K zu informieren. Bei jeder anderen Informationsquelle wäre es schwierig gewesen, der Vp im vorhinein einen Eindruck darüber zu vermitteln, welche Meinung die Quelle vertritt. Dennoch könnte es sein, dass die Vpn jetzt nicht nur vor dem Problem standen, die Vertrauenswürdigkeit von K zu überprüfen, sondern auch noch abzuklären, welchem der Kollegen vertraut werden kann. Es ist also nicht ganz auszuschliessen, dass diese "doppelte" Vertrauenssituation mit dazu beigetragen hat, dass Vpn bei ihrer Informationsbeschaffung besonders ausgewogen vorgegangen sind. Abschliessend ist festzuhalten, dass die Befunde vielversprechend sind und nahe legen, dass Personen eine diagnostische Strategie bei der Wahl von Informationsquellen bevorzugen. Andere Autoren, wie beispielsweise Trope und Bassok (1982) konnten zwar ebenfalls belegen, dass Personen beim Hypothesentesten diagnostisch vorgehen. Sie haben jedoch nicht die Wahl von Informationsquellen untersucht, sondern die Präferenz von Personen, wenn diese zwischen vorgegebenen diagnostischen und nichtdiagnostischen Fragen zu wählen hatten. Es wäre wichtig, in weiteren Untersuchungen zu überprüfen, ob sich die von uns gefundenen Ergebnisse auch dann erhärten lassen, wenn aufgrund veränderter Operationalisierungen die Misstrauens- bzw. Vertrauenskosten in höherem Mass von den Vpn empfunden werden, als dies offensichtlich in den bisher durchgeführten Experimenten der Fall war.