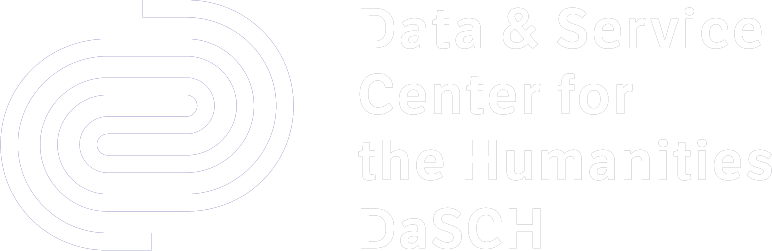Habilitationsagenda
Inhalt, Gliederungs- und Zeitplan der Monographie Deviante Körper/Deviant Bodies
1. Inhalt
Dass das Ideal des gesunden, jungen, bewegungs- und leistungsfähigen Körpers als ein Ausdruck westlicher Leistungsgesellschaften zu verstehen ist und diese Körper aus der diskurstheoretischen Perspektive als Materialisierung der gesellschaftlichen Diskurse verstanden werden können, ist bereits vielfach rezipiert, diskutiert und kritisiert worden (Alkemeyer; Butler; Cregan; Gugutzer; Klein; Shilling; Villa u.a.). Vor diesem Hintergrund des Literatur- und Forschungsstandes geht es in dem Habilitationsvorhaben um die Analyse gegenwärtiger Diskurse zu als abweichend, nicht ideal, ungesund, unbeweglich, uneindeutig und leistungsschwach, also als "deviant" kontextualisierten Körpern. Um Tiefenstrukturen und interdependente Verschränkung von Wissen und Macht in der Produktion von Diskursen und deren Effekte auf Subjekte in der westlichen Dominanzkultur in den Blick zu bekommen, folgt das Forschungsvorhaben den theoretischen und methodologischen Ansätzen der poststrukturalistischen (de-) konstruktivistischen Diskurs- und Dispositivtheorie und schliesst an Foucaults gouvernementalitätstheoretische Überlegungen (2004, 2006 u. 1978) an. Zudem werden die Gender und Cultural Studies, feministisch postkoloniale und posthumanistische Positionen, sowie Paradigmen der Critical Whiteness berücksichtigt (u.a. Butler; Bhabba, Dietze; Fraser; Hall; Haraway, Mohanty; Said; Spivak). In der methodischen Umsetzung ist die Forschung an aktuellen Ansätzen und Publikationen zur Diskurs- und Dispositivanalyse, die zugleich auch als Foucault-Rezeptionen verstanden werden können (u.a. Angermüller, 2010; Bührmann & Schneider, 2008; Jäger, 2000; Jäger & Jäger, 2007; Keller, 2004 u. 2008; Link, 2006), orientiert. Foucault folgend verweist der diskursiv konstituierte Idealkörper immer auch auf den diskursiv konstituierten, abweichenden, nicht idealen Körper. Aus dieser Perspektive geht es um die Frage, wie abweichende Körper in Diskursen zu Körper- und Bewegungspraxen im Feld des Sport-, diskursiv konstituiert und konnotiert werden. Grundlegende Annahme ist, dass z.B. die als krank, widernatürlich, fremd oder auch medizinisch nicht eindeutig kategorisierten Körper als ein kollektives Problem kontextualisiert werden. Die häufig feldübergreifenden Bezeichnungs- und Inszenierungspraxen, die auf interdependente Verschränkungen von Inter- und Spezialdiskurse verweisen (Jäger, 2000), werden in gesundheits-, bildungs-, sport- und integrationspolitischen Diskursen analysiert. Bezugspunkte in diesen Prozessen sind die "Technologien des Selbst" (Foucault, 1993) die ihre verhaltens- und wahrnehmungswirksamen Effekte dadurch erzeugen, dass sich die Subjekte nur schwer dem diskursiven Wissen entziehen können. Vielmehr wird der vermeintlich deviante Körper durch das Wissen um seine "Verhinder- und Normalisierbarkeit" zunehmend modifiziert. Diese Modifikations- und Transformationsprozesse sind von normativen Grenzziehungen begleitet, in denen soziale Ordnungen ontologisiert werden. Diese diskursiven Effekte der Re- und Dekonstruktionen von Subjektkonstitutionen werden am Beispiel von fünf unterschiedlichen Themenfeldern des Sports herausgearbeitet und auf Gemeinsamkeiten und Differenzen in der Monographie diskutiert. Von untersuchungs-leitendem Interesse ist, wie Körperdiskurse in Körper- und Bewegungspraxen wirklichkeitskonstituierend realisiert und Normgefüge aktualisiert, stabilisiert aber auch modifiziert werden. Eine differenzierte Untersuchung der Autonomie und Interdependenz der sozialen Felder, aber auch der soziologischen Frage zum Wirkungszusammenhang zwischen Struktur und Praxis bzw. Diskurs und Praxis-Relation wird vorgelegt. Der Einstieg zu den diskursanalytischen Untersuchungen zu "devianten Körpern" wird am Beispiel der sportpädagogischen Adipositasdiskurse und der damit einhergehenden institutionell induzierten gesundheitspolitischen Kampagnen und Praxiskonzepte unternommen (Kap. 3). Die folgenden Kapitel analysieren ebenfalls Tiefenstrukturen der Diskurse und Dispositive zu Burkiniverboten in öffentlichen Bädern und Gewässern am Beispiel der Schweiz (Kap. 4), dem "wahren" Geschlecht der südafrikanischen Athletin Caster Semenya (Kap. 5), der olympischen Zulassung des prothetisierten Körpers eines Oscar Pistorius (Kap. 6) und den als "Dopingsünder" bezeichneten Hochleistungssportbetreibenden (Kap. 7). Gemeinsam ist den genannten Körperdiskursen aus der eingangs skizzierten theoretischen Perspektive, dass sie auf soziokulturell konstruierte Werte und Normen rekurrieren und normative soziale Grenzziehungen durch ihre "Widerspenstigkeit" erkennen lassen. Grundlegende Annahme ist, dass sportive Körper- und Bewegungspraxen fundamentale Subjektivierungs- und Organisationspraxen westlich orientierter Gesellschaften bilden, die der Kollektivformierung dienen. In diskursiven Praxen werden, insbesondere im Feld des Sports, historisierte, aufklärerische Werte der Natürlichkeit, Fairness und Gleichheit reformuliert und stabilisiert. Von dieser Annahme ausgehend wird ein verstärkter Fokus in der Forschung darauf gelegt, dass sich zwar körperliche Praktiken durch Diskurse materialisieren, sich jedoch nicht widerspruchslos als soziale Wirklichkeiten realisieren, da sie auch Widerstände, nicht intendierte Effekte und subjektive Sinnzuschreibungen hervorrufen. Die auf der makrosoziologischen Ebene destillierten diskurs- und dispositivanalytischen Ergebnisse, die den Status des Körpers als Ordnungskategorie fokussieren, werden auf meso- und mikrosoziologischer Ebene u.a. durch Bloganalysen im Internet, Beobachtungen im Feld, sowie in Einzel- und Gruppenbefragungen durch qualitative Interviews überprüft. Im Fokus der Überprüfung wird der konkreten Frage nachgegangen, wie sich überwiegend medial vermittelte Diskurse in Körperpraxen niederschlagen, aber auch umgedeutet und in weiterführenden Diskursen und Körperpraxen transformiert werden. Explizit wird danach gefragt, welche Wert- und (Um-) Deutungsmuster sowie typisierbare (narrative) Strukturen sich in den unterschiedlichen Feldern der körperlichen Praxis des Sports zu körperlicher Diversität identifiziert lassen. Ziel ist es zu erfassen, welche körper- und bewegungspraktischen Anstrengungen in Feldern des Sports unternommen werden, um Körper an etablierte Werte und Normen der Mehrheitsgesellschaft anzupassen und vor allem, wie diese in den jeweiligen sozialen Feldern als subjektive Wert- und Normen rezipiert, transformiert und inkorporiert werden. Zentral für die Verwendung der Begriffe Werte und Normen sind in diesem Zusammenhang die jüngeren Ausführungen Judith Butlers, die in Anlehnung an Foucault den "Doppelcharakter der Normen" (Butler, 2009, S. 329) präzisiert. Die Normen, die einerseits als regulierend und normalisierend, als der Träger der Macht in restriktiver Weise zu beschreiben sind; und andererseits das sind, was Individuen verbindet, da sie "Grundlagen ihrer ethischen und politischen Ansprüche bilden" (Butler, 2009, 348). Durch diesen Doppelcharakter bedürfen sie laut Butler einer permanenten kritischen Analyse und Reflexion, die auch richtungsweisend für dieses Forschungsprojekt ist. Übergeordnetes Forschungsziel ist es, aus den vielfältigen Perspektiven auf die als deviant markierten Körper, Rückschlüsse auf dominante, aber auch zugleich kontingente Deutungsmuster in der Sport- und Bewegungskultur zu ziehen. Um körpersoziologische Perspektiven als integralen Bestandteil einer politischen Analyse moderner Gesellschaften zu erfassen, wurde bisher nur marginal der gouvernementalitätstheoretische Ansatz in Anlehnung an Foucault im Untersuchungsfeld des Sports genutzt. Durch diesen Ansatz wird die Gouvernementalitätsforschung um die sportfeldspezifische Perspektive bereichert. Körperdiskurse und -praxen wurden auf ihre Intersektionalität bezüglich den geschlechtlichen, kulturellen, ethnischen, religiösen, politischen, ethischen, pädagogischen, sowie ontologischen Implikationen bisher in nur vereinzelten, diskurstheoretisch-orientierten Publikationen untersucht.
2. Gliederung Deviante Körper/Deviant Bodies
1. Einleitung
2. Einführung in die theoretischen und methodologischen Ansätze
3. Gewichtige Körper
4. Verhüllte Körper
5. Intersexuelle Körper
6. Prothesenkörper: Gehandicapte Körper oder Cyborgs im Leistungssport (Theoretische Reflexion auf der Grundlage posthumanistischer
7. Gedopte Körper
8. Abschlusskapitel