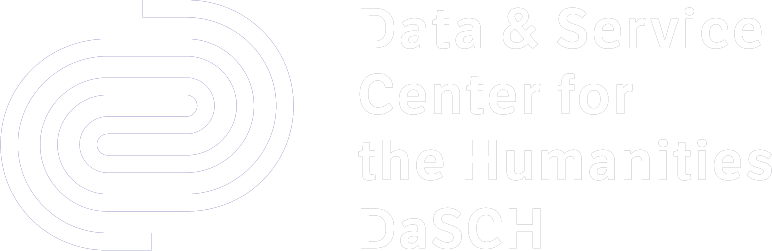Ein grosser Vulkanausbruch kann das Klima innerhalb weniger Monate stärker verändern als der viel diskutierte Klimawandel. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis: Als der Tambora auf Sumbawa (Indonesien) im April 1815 ausbrach, folgte auf eine der grössten bekannten Vulkaneruptionen der jüngsten Erdgeschichte ein "Jahr ohne Sommer". Anhaltende Kälte und Schneefälle liessen den Sommer 1816 zu einem der kältesten der letzten 500 Jahre werden und zogen in Mittel- und Westeuropa grosse Ernteausfälle und eine riesige Teuerungswelle nach sich. Nahrungsmittel wurden für die Mehrheit der Bevölkerung zu einem unerschwinglichen Gut; Mangelernährung, Krankheiten und Bevölkerungsverluste waren die Folge.
Die Krise wirkte sich unterschiedlich auf die Nahrungssicherheit in der Schweiz aus. Während in der Ostschweiz eine Hungersnot ausbrach und die Zentralschweiz unter einer Hungerkrise litt, hatten in der Westschweiz die meisten Regionen nur unter Nahrungsmangel zu leiden. Fallstudien sollen die Handlungsspielräume der Regierungen ausloten und die Ursachen der räumlichen Unterschiede aufzeigen. Die Schicksale der Betroffenen, die sich hinter den Bergen von Akten und Zahlen verstecken, sollen dabei nicht ausgeblendet werden: Ego-Dokumente, Zeitungen und Zeitschriften lassen die Konturen ihrer Lebenswelt erkennen und erahnen, wie sie die Krise wahrnahmen.
Als theoretische Grundlage zur Erforschung von Subsistenzkrisen hat sich in den letzten Jahren das interdisziplinäre Konzept der Verletzlichkeit durchgesetzt. Es ermöglicht die Untersuchung gesellschaftlicher Bereiche, die sich durch das Auftreten bestimmter Ereignisse als besonders verletzlich erwiesen.